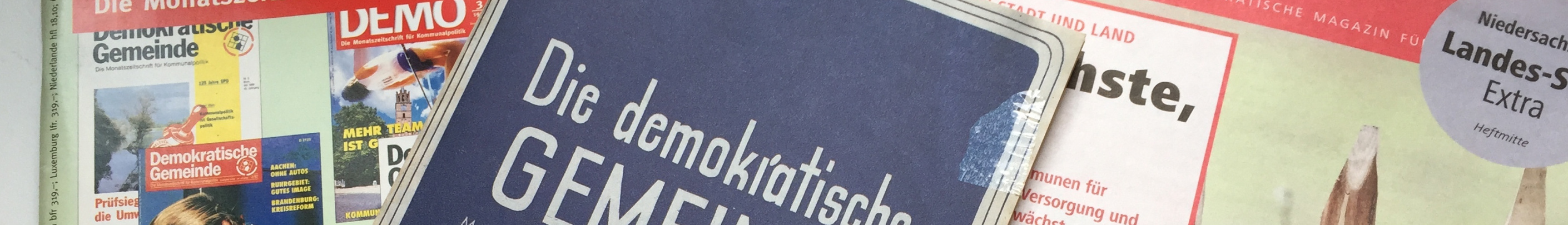Die Geschichte der sozialdemokratischen Kommunalpolitik ist eng verwoben mit der Demokratisierung der kommunalen Selbstverwaltung. Erst mit der Revolution von 1918 wurde die SPD zur Kommunalpartei, die sie bis zum heutigen Tage geblieben ist.
Kaiserreich: „Herrschaft des Geldsacks“
Am Anfang war die Sozialdemokratie jedoch bei der Kommunalverwaltung außen vor. Der Grund war schlicht das Vorherrschen undemokratischer Wahlsysteme auf kommunaler Ebene. Während auf Reichsebene immerhin „ein Mann, eine Stimme galt“, dominierte auf Gemeindeebene die besitzende Minderheit die mittellose Mehrheit.
Unter diesen Bedingungen wurde in der SPD kontrovers die Frage erörtert, ob man sich überhaupt an Kommunalwahlen beteiligen solle. Der revolutionäre Flügel hielt nicht viel von der Beteiligung an unfairen Wahlen und von der Gemeindedemokratie im Allgemeinen. Selbst nachdem er zehn Jahre Stadtverordneter war, war für Karl Liebknecht (SPD) die Kommune nur ein Ableger des Zentralstaates. Diesen zu erobern, hatte Vorrang. Die Sozialdemokraten, die sich als Pragmatiker sahen, strebten dagegen in die kommunalen Vertretungskörperschaften. Eduard Bernstein schrieb der Kommunalpolitik eine Pionierfunktion zu und sah in ihr einen geeigneten Ansatz sozialistischer Reformarbeit.
Entschieden wurde die Grundsatzfrage programmatisch erst im Jahre 1904 auf dem SPD-Parteitag in Bremen mit dem ersten kommunalpolitischen Programm. Die ersten Programmpunkte forderten die Demokratisierung der Gemeindepolitik und echte Selbstverwaltung. Danach ging es mit heute altvertrauten Themen weiter: Gebührenfreiheit für Schulen und Krankenhäuser, das Recht, kommunale Unternehmen nicht kaufmännisch, sondern sozialpolitisch auszurichten, und zum Beispiel eine Steuer auf unverdienten Wertzuwachs von Grund und Boden. Innerparteilich stellte die Resolution die Anerkennung der Kommunalpolitik als eigenständigen Bereich neben der „großen Politik“ dar, selbst wenn ihre Rolle auf dem Weg zum Sozialismus unbestimmt blieb.
Zahl sozialdemokratischer Mandatsträger steigt an
Die Realität hatte die innerparteilichen Debatten über die Beteiligung an Wahlen zwischenzeitlich sowieso überholt. Der Anteil sozialdemokratischer Stadt- und Gemeindeverordneter stieg kontinuierlich an. Erste einzelne Vertreter fanden sich bereits in den 1860er Jahren. Mit der Abschaffung des Wahlmänner-Systems und Einführung der Direktwahlen in Sachsen (damals Hochburg der SPD und ein Hort der demokratischen Bewegungen) stieg dort ab dem Jahr 1870 die Zahl sozialdemokratischer Mandatsträger deutlich an. In Süddeutschland errang die Sozialdemokratie erstmals im Jahre 1878 ein Mandat (in Mannheim), Berlin folgte mit Paul Singer und Franz Tutzauer im Jahr 1883.
Am Berliner Beispiel kann man die manipulativen Mechanismen des preußischen Kommunalwahlrechts zeigen, das andernorts kopiert wurde. Die Wahl fand an einem Werktag statt, wurde um 17 Uhr beendet, erfolgte mit öffentlicher Stimmabgabe, und wer mehr Steuern zahlte, hatte faktisch höheres Stimmgewicht. In der Hälfte der Wahlbezirke durften nur Grund- und Hauseigentümer gewählt werden. Die SPD schmähte dieses Unrecht völlig zu Recht als die „Herrschaft des Geldsacks“.
Diese Ungerechtigkeiten verhinderten nicht, dass die SPD immer stetiger Vertreter in die Gemeindevertretungen entsenden konnte. Waren es im Jahr 1909 fast 6.200 Vertreter in rund 2.100 Gemeinden, stieg diese Zahl in fünf Jahren auf fast 12.000 in 3.600 Gemeinden. Der Weltkrieg führte sogar dazu, dass einige sozialdemokratische Magistratsmitglieder von den Aufsichtsbehörden zugelassen wurden, dem Burgfrieden zuliebe.
Für die bisher in den Gemeinden vertretenen Honoratioren war das ein Schock. Sahen sie sich selbst doch als Vertreter des Gemeinwohls, während die SPD als Klassenpartei die Interessen ihrer Wähler vertrat. So schrieb der Oberbürgermeister von Königsberg Dr. Körte von dem „Hervortreten parteipolitischer Agitation, insbesondere das immer stärkere Eindringen der Sozialdemokratie in die Selbstverwaltungskörperschaften, mit der grundsätzlich völligen Rücksichtslosigkeit ihres Vorgehens in der Kritik wie im Drängen auf ihre Sonderziele“.
SPD vertritt als Klassenpartei die Interessen ihrer Wähler
Richtig ist, dass mit der Sozialdemokratie eine „Politisierung der kommunalen Selbstverwaltung“ stattgefunden hat. Die Stärke der SPD lag jedoch vor allem darin, das stillschweigende Einvernehmen der Honoratioren im Rat zu stören, auf Missstände hinzuweisen und in den Ausschüssen die Verwaltung zu kontrollieren. Letzten Endes musste Dr. Körte widerwillig feststellen, dass „nicht wenige fähige, auf manchen Gebieten auch zu gemeinnütziger Mitarbeit … bereite Männer auch aus den Reihen der Sozialdemokratie“ stammen.
Die wirkliche Geburt der demokratischen kommunalen Selbstverwaltung und der SPD als Kommunalpartei war der 12. November 1919. An diesem Tag veröffentlichte der Rat der Volksbeauftragten den Aufruf „An das deutsche Volk”, in dem der letzte Satz alle manipulativen Wahlregime hinwegfegte: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“ Damit fielen die Schranken, die die SPD davon abgehalten hatten, den Platz im Gemeindeparlament einzunehmen, der ihr zugestanden hätte. An vielen Orten zogen die Sozialdemokraten erstmalig in die Gemeindevertretung ein und das oft mit absoluter Mehrheit. Anfangs unüberschaubar gab es selbst im Jahr 1929 noch rund 46.000 Gemeindevertreter, die der SPD angehörten, darunter etwa 850 Frauen.
Das hauptamtliche Personal der Kommunalverwaltung änderte sich nicht so grundlegend wie die Vertretungskörperschaften. Nur in neun der 24 Großstädte des Reiches kam es nach den demokratischen Wahlen zu einem Wechsel des Oberbürgermeisters. Die Gründe dafür waren zum einen der Mangel an geeignetem, juristisch geschultem Verwaltungspersonal in der SPD, um alle Stellen neu zu besetzen. Zum anderen existierte ein relativ breiter Konsens zwischen den Parteien der Weimarer Koalition aus SPD, DDP und Zentrum, was zu einer bürgerlichen Kontinuität der Verwaltungsspitzen beitrug. Ausnahmen von dieser Regel gab es jedoch auch. Philipp Scheidemann, der im Jahr 1918 die Republik ausgerufen hatte und ihr in 1919 als Reichsministerpräsident diente, wurde im Dezember 1919 zum Oberbürgermeister von Kassel gewählt. Er übte das Amt bis zum Jahr 1925 aus. Noch vor ihm war Robert Leinert in Hannover zum Stadtoberhaupt gewählt worden, und zwar am 13. November 1918. Damit war er der erste sozialdemokratische Oberbürgermeister an der Spitze einer deutschen Großstadt.
Die SPD institutionalisiert parteiinterne kommunale Strukturen
Mit der anwachsenden Zahl und Bedeutung sozialdemokratischer Mandatsträgerinnen und -träger institutionalisierte die SPD ihre parteiinternen kommunalen Strukturen. Die Zeitschrift „Die Gemeinde, Halbmonatsschrift für sozialistische Arbeit in Stadt und Land“ erschien ab 1924 bis zu ihrem Verbot 1933. Sie war also die Vorgängerin der heutigen DEMO. Am 22. Mai 1927 fand die erste kommunale Reichskonferenz der SPD mit 400 Kommunalpolitikern statt. Themen waren der Finanzausgleich und das Problem der Ferngasversorgung.
Die kommunalpolitischen Richtlinien der Partei folgten im Jahr darauf, 1928, unter anderem mit großen Forderungen nach der Kommunalisierung von Bedarfsversorgung (Strom, Gas, Wasser) und kleineren, wie beispielsweise der nach der Schaffung von Dauerkleingärten.
Neue Republik zentralistischer organisiert als Preußen
Die unbestreitbare Sozialdemokratisierung der kommunalen Selbstverwaltung war tragischerweise verbunden mit einem Verlust kommunaler Gestaltungsspielräume. Zwar wurde die kommunale Selbstverwaltung im Artikel 127 der Weimarer Verfassung festgeschrieben, und doch war die neue Republik zentralistischer organisiert als das kaiserliche Preußen.
Mit der Erzbergerschen Finanzreform von 1919/1920 sank der Anteil der Gemeinden an der Lohnsteuer drastisch. Waren es in den Jahren 1913/14 noch mehr als 56 Prozent, fielen 1931/32 keine 28 Prozent mehr vom Lohnsteuerkuchen an die Gemeinden ab. Mit der Weltwirtschaftskrise gingen die Gemeinden vollends in die Knie: Wegbrechende Einnahmen, Inflation und explodierende Sozialausgaben beraubten sie jeglichen Handlungsspielraums.
Tatsächlich konnte der sogenannte „kommunale Sozialismus“ der SPD selbst unter diesen dramatischen Rahmenbedingungen Erfolge vorweisen, die bis heute nachhallen. Viele Bereiche des modernen Sozialstaates entstanden in dieser Zeit. In dem Bereich Jugendfürsorge wurde die obrigkeitsstaatliche Verwahrung durch moderne Jugendarbeit ersetzt. Außerdem löste ein humanerer Strafvollzug das unmenschliche Gefängniswesen des Kaiserreichs ab. Die Krankenversorgung der Bevölkerung wurde verbessert, allein in Berlin sank die Säuglingssterblichkeit von 17 auf sechs Prozent. Am prägendsten sind vermutlich noch immer die Wohnungsbauten, die in Abgrenzung zu den Mietskasernen vor dem Krieg in moderner Architektur errichtet wurden. In Preußen alleine waren es 1,5 Millionen Wohneinheiten, die in zehn Jahren gebaut wurden.
Sozialdemokratische Kommunalpolitiker hatten sich am Ende der Weimarer Republik einen so guten Ruf erarbeitet, dass Walter Ulbricht nach 1945 für den Aufbau der Selbstverwaltung seinen Genossen empfohlen hatte, am besten Sozialdemokraten zu nehmen. Denn die verstünden etwas von Kommunalpolitik.