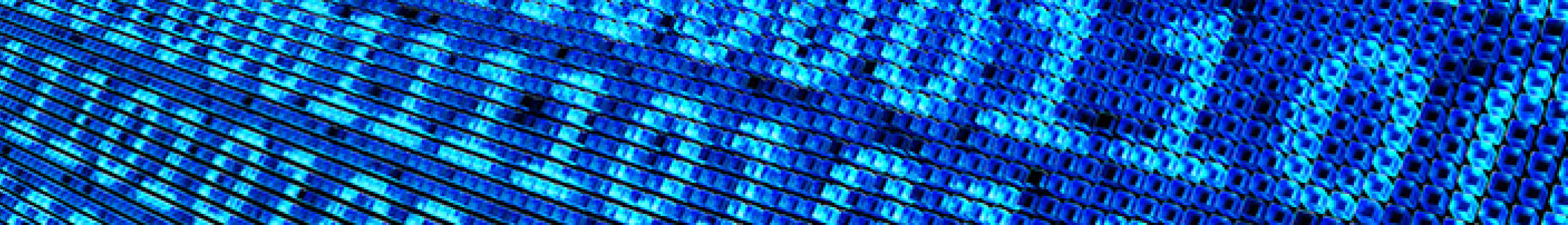Sie wollten eine Plattform schaffen, in der es nicht um Reklame geht. Es sollte eine Plattform werden, in der Unternehmer, Vereine und Sozialverbände mit allen ihren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Mitgliedern kommunizieren können. Die Entwicklung des Unionviertels digital – das ist es, was unter anderem dem Vertreter des Unionviertelvereines, Hans-Gerd Nottenbohm, vorschwebte.
Die Idee ist längst in die Tat umgesetzt. Denn das Viertel rund um das Dortmunder U gehört zu den 14 Bürgerwerkstatt-Modellprojekten, die vom Landesministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, das mit digitalen Werkzeugen und Schulungen unterstützt wurden. Heute ist es mit Leben erfüllt.
Nachbarn ohne Facebook zusammenbringen
Das Viertel, das nun ein eigenes Intranet besitzt, hat eine bedeutende Vergangenheit. Hier befanden sich große Arbeitgeber und viele Arbeitsplätze. Den Menschen ging es gut. Größte Arbeitgeber waren Hoesch (Stahl) und die Dortmunder Union-Brauerei. An den Stahlhersteller erinnern leerstehende, riesige Industriegebäude und an die Union-Brauerei das Dortmunder U – einst strahlendes Firmenlogo auf einem großen Brauereigebäude, heute ein weithin sichtbar vergoldetes U auf einem Kulturmagneten. Rund 12.000 Menschen leben hier friedlich miteinander. Oder besser gesagt nebeneinander. „Wir hoffen, dass sich letzteres ändern wird und die Plattform dazu beiträgt, dass man sich kennenlernt und miteinander spricht“, benennt Projektleiter Nottenbohm ein konkretes Ziel. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze – natürlich wünschen sich das alle hier – ist der wirtschaftliche Aspekt dieser Form von Digitalisierung.
Hans-Gerd Nottenbohm war es, der im Jahre 2015 auf die Ausschreibung der Quartiersakademie gestoßen war. Die Möglichkeit, dass ein Viertel bei der Digitalisierung unterstützt wird und Bewohner Schulungen besuchen können, fand er toll. „Viele unserer Mitglieder lehnten Facebook als Kommunikations-Plattform ab. Sie haben ein totales Sicherheitsbedürfnis. Doch diese Möglichkeit war wirklich überzeugend“, erinnert er sich. So bewarb sich der Verein und erhielt den Zuschlag.
Mehr Beteiligung, besserer Zugang zu Wissen
Genutzt wird das Intranet heute vor allem bei Fragen der Veröffentlichung von Protokollen aus der örtlichen Bezirksvertretung sowie der Beteiligung an der Gestaltung von Plätzen. Soll ein Spielplatz neu belebt werden, werden heute Bilder und Videos von der alten Fläche ins Netz gestellt, so dass sich alle ein Bild vom Ist-Zustand machen können. Darauf beruhen dann Vorschläge für Neuerungen. Diese werden an die Stadt weitergereicht. In diesem Sinne hatte sich auch Susanne Linnebach, Leiterin des Amtes für Wohnung und Stadterneuerung, bei der Vorstellung des digitalen Quartieres geäußert: „Wir könnten uns durchaus vorstellen, Bürger über solche Umfragen zu beteiligen.“ Mitglied bei der Plattform kann man nur auf Einladung werden.
Bianca Herlo, zuständige Projektleiterin für „Bürger vernetzen Nachbarschaften“ im Design Research Lab der Berlin University of the Arts am Lehrstuhl von Professorin Gesche Joost, erläutert die Grundidee des Projektes so: Seit einigen Jahren werde verstärkt und aus verschiedenen gesellschaftlichen Richtungen über neue Formen von Gemeinschaftlichkeit und Gemeinwohlorientierung diskutiert. Es entstünden neue Praktiken und Initiativen, wie beispielsweise Urban Gardening, Tauschbörsen, Repair-Cafés und alternative Formen des Zusammenlebens wie Gemeinschaftswohnprojekte. Digitale Mittel und Medien verstärkten diese Vergemeinschaftungsprozesse. Digitale Plattformen schafften neuen Zugang zu Wissen und Information und förderten die Teilhabe an gesellschaftlichen Transformationsprozessen.
Digitale und soziale Vernetzung
Die Frage, was Nachbarschaft, was ein Quartier, mit der digitalen Herausforderung unserer Zeit zu tun hat und warum Industrie 4.0 auch noch nach Feierabend unser Leben bestimmen soll, beantwortet die Expertin so: „Der technologisch induzierte Wandel unserer Gesellschaft ist im Beruf wie im Alltag bereits allgegenwärtig. Umso mehr sind wir als Expertinnen, als politische Entscheidungsträger, als Zivilgesellschaft und Individuen gefragt, die digitale Spaltung der Gesellschaft zu reduzieren und für die interkulturelle und intergenerative Verständigung zu sorgen.” Digitale Vernetzung, beteuert Bianca Herlo, „kann jedoch nicht ohne soziale Vernetzung gedacht werden“.
Mehr
www.unionviertel.de