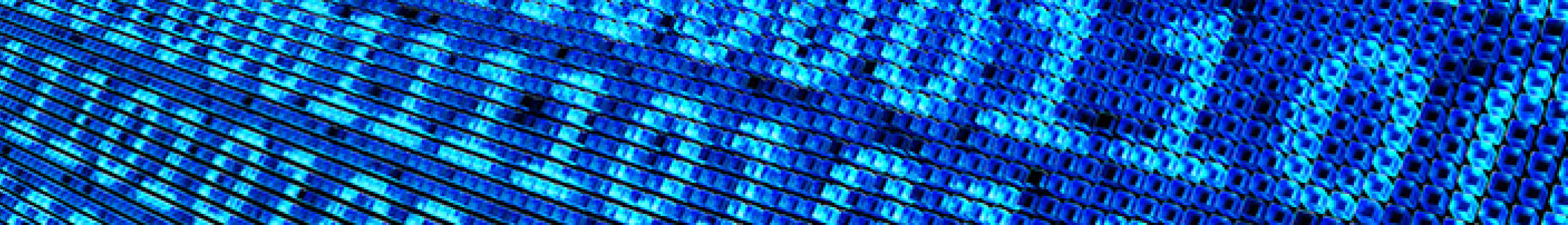DEMO: Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer Datenstrategie. Worum geht es da?
Elvan Korkmaz-Emre: Wir versprechen uns davon, dass die Bundesregierung festsetzt, wie der Umgang mit Daten in Deutschland geregelt werden soll – dass sie also Leitplanken und Wegweiser aufstellt. Wir müssen sehen, was am Ende tatsächlich drinsteht. Was wir uns als SPD-Fraktion wünschen, haben wir in einem Positionspapier aufgeschrieben.
Was sind die wichtigsten Punkte des SPD-Papiers?
Kurzgefasst: Daten sind derzeit eine ganz wichtige Grundlage vor allem bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Sie könnten aber auch Treiber von sozialen Innovationen sein. Deshalb wollen wir nicht, dass die Daten nur bei den großen Unternehmen liegen. Hier könnte ein Datentreuhänder die Möglichkeit bieten, den Zugang zu Daten zu verbreitern. Wie das im Detail aussehen kann, müssen wir noch festlegen.
Sicherlich müsste aber auch ein Daten-Teilen-Gesetz die Unternehmen dazu verpflichten, bestimmte Daten zu teilen. Ziel ist, dass nicht nur einige große Kraken über die Datenmacht verfügen, sondern auch andere sie sektoral nutzen können. Und natürlich soll die Bundesverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Daten bereitstellen.
In dem Positionspapier der SPD-Fraktion steht, mit sozialen Innovationen könne auch die Daseinsvorsorge besser auf die Bedürfnisse der Menschen ausgelegt werden. Was haben Daten mit Daseinsvorsorge zu tun?
Ein Beispiel ist der Nahverkehr: Wenn Menschen mit dem Smartphone unterwegs sind und Tickets kaufen, generieren sie Daten. Diese kann man nutzen, um die Mobilitätsleistungen für alle Nutzer*innen attraktiver zu machen. Bisher liegen diese – nicht personenbezogenen – Daten oft bei einzelnen Unternehmen oder bei Internetserver-Anbietern, die offenes WLAN zur Verfügung stellen. Damit passiert momentan gar nichts.
Dieses Prinzip lässt sich auch auf andere Felder übertragen, sei es die Energieversorgung oder das Gesundheitssystem. In Berlin gibt es zum Beispiel die Aktion „Gieß den Kiez“. Online kann man sich informieren, welche Straßenbäume es in der Nachbarschaft gibt und welchen Wasserbedarf diese jeweils haben. Man kann auch einzelne Bäume „adoptieren“. So ein Beispiel lässt sich leicht auf andere Bereiche oder Kommunen übertragen, wenn man die notwendigen Daten hat. Deshalb setzen wir uns als SPD auch für Open-Source- und Open-Data-Ansätze ein.
Die digitale Wirtschaft neigt zu Monopolisten: Unternehmen wie Google, Amazon oder Facebook drängen alle anderen vom Markt. Daseinsvorsorge ist bisher eher dezentral organisiert: Mit vielen lokalen Stadtwerken oder Bahnunternehmen. Wie lässt sich verhindern, dass auch das Leben in den Städten – wenn die „Smart City“ Realität wird – zunehmend von Großkonzernen bestimmt wird?
Die Sorge ist absolut berechtigt. Ich höre auch, wenn ich mit Bürgermeister*innen rede, dass die Ressourcen vor Ort insbesondere in kleinen Gemeinden kaum vorhanden sind, um Ideen zu entwickeln, was man mit Daten machen kann. Also bieten die großen und erfahrenen Unternehmen ihre Dienste an. Das klingt erst einmal gut. Dass dann aber die Daten weg sind, wenn sie erst einmal bei den Unternehmen liegen, haben noch viel zu wenige Kommunen im Blick.
Wir müssen dahin kommen zu sagen: Wir brauchen Smart City, wir brauchen smarte und digitale Lösungen vor Ort. Aber diese brauchen wir nicht um der Digitalisierung selbst willen. Die Digitalisierung soll das unterstützen, was die Kommunen ohnehin für die Bürger*innen machen, indem man es mit digitalen Lösungen effektiver und einfacher voranbringt. Wir sollten keine Black Box schaffen, bei der die Bürger*innen sich gar nicht vorstellen können, wie die Smart City von morgen aussieht.
Und wir müssen verstehen: Das schafft nicht jede Kommune dezentral. In meinem Heimatkreis hat die Stadt Gütersloh einen Digital-Ansatz. Manch kleine Kommunen drumherum hat aber gar nicht die Power dafür, daher macht die dann auch nichts. Wenn wir davon loskommen wollen, dass die Verwaltungen von großen Anbietern wie Microsoft dominiert werden, dann müssen wir das zumindest zum Teil zentral lösen bzw. über interkommunale Kooperation. Anders wird das nicht funktionieren. Trotzdem ist es möglich unsere föderalen Stärken in so eine System-Architektur zu integrieren. Ansätze dazu gibt es ja schon in den Verbänden, in denen sich die Kommunen austauschen.
Wie könnten die zentralen Lösungen genau aussehen?
Man kann zum Beispiel selbst Softwarelösungen entwickeln und diese den Gemeinden an die Hand geben. Oder man kann die Kooperation von Kommunen fördern, die sich zusammentun, und gemeinsam Lösungen entwickeln. Wichtig ist: Wir müssen das Know-how von Leuten, die so etwas entwickeln können, stärker an die öffentliche Hand angliedern. Das geht nicht alleine mit Berater*innen aus dem freien Markt, wir brauchen das Wissen auch in den eigenen Häusern. Auch Open-Source-Software ist ein Ansatz, mit dem wir ein stückweit unabhängiger werden können. Und was häufig vergessen wird, wir haben auch heute schon kommunale IT-Dienstleister, die stark und konkurrenzfähig sind. Insofern bin ich optimistisch für die Zukunft. Es gibt aber noch einige Weichen dafür zu stellen.
Sie fordern einen Datenaustausch zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen, um Waffengleichheit herzustellen. Greifen Sie damit nicht auch in die Rechte der Bürger*innen ein, über die eigenen Daten zu verfügen?
Wir unterscheiden da zwischen verschiedenen Datenarten. Viele Menschen teilen auf Facebook mit, wo sie sich gerade befinden und mit wem sie was essen. Das sind personenbezogene Daten, und wer die Plattform nutzt, stimmt zu, dass er alles mit einem großen US-Konzern teilt. Facebook nutzt das zum Beispiel für gezielte Werbeanzeigen.
An diese Daten wollen wir nicht ran, im Gegenteil, hier wollen wir für die Nutzer*innen mehr Selbstbestimmung. Wir haben eine Definition für personenbezogene Daten, und diese unterliegen dem höchsten Schutz. Es gibt aber auch nicht-personenbezogene Daten, die also nicht auf eine einzelne Personen zurückzuführen sind. Von denen kann das Gemeinwohl profitieren und mit denen wollen wir arbeiten. Ein Beispiel sind die aggregierten Mobilitätsprofile für den öffentlichen Verkehr.
Das Online-Zugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Wie bewerten Sie den Stand der Umsetzung?
Es ist noch sehr viel zu tun, um da tatsächlich anzukommen. Die Uhr läuft, wir haben jetzt noch zwei Jahre. Die Bundesregierung muss selbst als Beispiel vorangehen und das macht sie auch: Es ist jetzt möglich, die Familienleistungen komplett digital in einem „Kombi-Antrag” zu organisieren. Davon bitte mehr. Bis wir das aber auf alle anderen Verwaltungsleistungen, und dann auch in die Kommunen, übertragen haben, da liegt noch ganz viel Arbeit vor uns. Mit den OZG-Finanzmitteln aus dem Konjunkturpaket und damit einer noch stärkeren Forcierung des „Einer für Alle“-Prinzips (Once-Only) wird seitens des Bundesinnenministeriums mit einem rascheren Fortschreiten der flächendeckenden Umsetzung in 2021 gerechnet.
Wir merken, dass viele große Städte schon gut dabei sind und selbst prüfen, was sie wie umsetzen können. Die kleinen Kommunen machen sich langsam auf den Weg und führen Gespräche mit den IT-Dienstleistern. Hier liegen große Chancen auf Interkommunaler Zusammenarbeit.
Die Frist bis Ende 2022, um alle Leistungen digital anzubieten, ist also ambitioniert?
Sehr ambitioniert, wenn man es vom aktuellen Stand aus betrachtet. Allerdings wurde das Gesetz bereits 2017 beschlossen, seitdem sind schon mehr als drei Jahre ins Land gegangen. Wir werden das Problem jetzt nicht lösen, wenn wir uns einfach noch mehr Zeit geben. Das Projekt besteht aus vielen kleinen Projekten und vieles wird Ende 2022 funktionieren. Grundsätzlich muss so ein Projekt innerhalb von fünf Jahren zu stemmen sein, sonst gibt die Digitalisierung in Deutschland kein gutes Bild ab.
Elvan Korkmaz-Emre ist SPD-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Digitale Agenda. Dieses Interview wurde bereits im November 2020 geführt. Für die Wiederveröffentlichung im Rahmen unserer Themenwoche „Digitalisierung” hat Kormaz-Emre uns teilweise aktualisierte Antworten zukommen lassen.